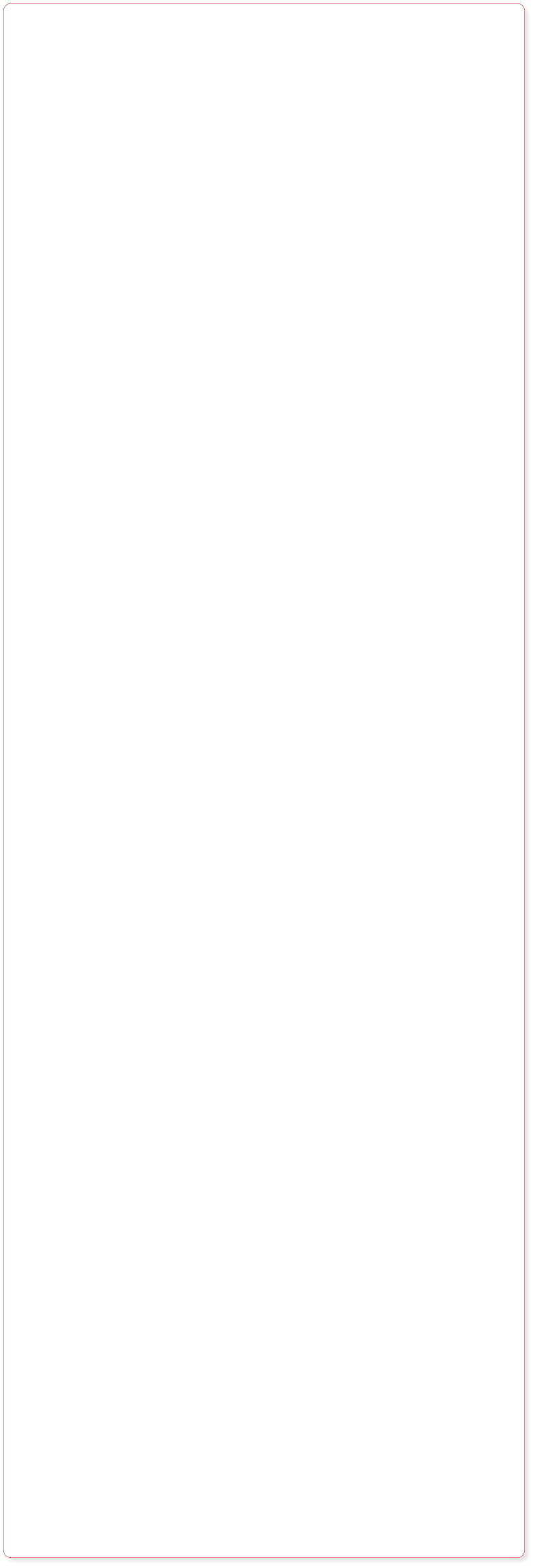


© Renate Dietrich

Ein leeres Boot am Strand - Leseprobe
Prolog
Das
über
ihm
zusammenschlagende
Wasser
ernüchterte
ihn
nur
für
einen
Augen-
blick.
In
diesem
Moment
begriff
er,
dass
er
in
großer
Gefahr
war
und
vielleicht
sterben
würde.
Er
schlug
mit
den
Armen
um
sich
und
erreichte
noch
einmal
die
Oberfläche.
Doch
bevor
er
schreien
konnte,
hatte
ihn
die
Schwere
seiner
Kleider
und
der
Stiefel
zusammen
mit
den
höherschlagenden
Wellen
wieder
nach
unten
gezogen
in
die
Tiefe
der fischigen Finsternis.
Automatisch
hatte
er
die
Augen
geschlossen,
um
sie
vor
dem
brennenden
Salz-
wasser
zu
schützen.
Aber
dennoch
sah
er
Susan
so
deutlich,
als
stünde
sie
vor
ihm
und
hielte
Edith
an
der
Hand,
Edith,
das
kleine
Mädchen
mit
großen
erschrockenen
Augen.
Nun
kamen
Mutter
und
Tochter
auf
ihn
zu.
Als
ob
sie
ihn
retten
könnten,
wenn
sie
ihn
nur erreichten!
Er
riss
den
Mund
auf,
weil
er
das
mörderische
Zerren
in
der
Brust
nicht
mehr
ertragen
konnte
und
schluckte
salziges
Meerwasser,
während
sein
Körper
unterging
und sein Bewußtsein in der Dunkelheit versank.
Kapitel 1
Es
hatte
seit
Tagen
geregnet.
Steven
hatte
nachts
die
Tropfen
gegen
die
Scheiben
trommeln
hören,
als
er,
wie
so
häufig
in
den
letzten
Nächten,
viel
zu
lange
wach
lag,
um
nicht
immer
wieder
in
demselben
Albtraum
unterzugehen.
Gegen
fünf
war
er
auf-
gestanden
und
nach
draußen
gegangen.
Über
den
Bergrücken
im
Osten
hatte
sich
unterhalb
der
dichten
dunklen
Wolken
ein
Band
bläulichrosa
Scheins
ausgebreitet,
bis
schließlich
in
einem
überwältigenden
Augenblick
das
Licht
der
Sonne
durchgebrochen
war
und
das
Tal,
die
Berge
und
das
Meer
mit
silbrigem
Leuchten
überzogen
hatte,
als
wäre dies der Augenblick der Schöpfung.
Als
er
nach
dem
Frühstück
die
große
Reisetasche
und
seine
Wanderstiefel
in
den
Kofferraum
packte,
war
die
Sonne
schon
lange
wieder
hinter
den
Wolken
ver-
schwunden,
die
jetzt
so
tief
hingen,
dass
er
die
andere
Seite
der
Bucht
nur
ahnen
konnte.
Für
einen
Augenblick
hatte
der
Regen
sich
eine
Pause
gegönnt,
aber
immer
noch
durchdrang
die
feuchte
Kühle
alles.
Er
blickte
auf
die
immer
noch
aufgewühlte
Wasserfläche und fühlte wieder die eisige Kälte und das abgrundtiefe Entsetzen.
Er
verscheuchte
die
Erinnerung
an
seinen
Albtraum,
so
gut
es
ging,
und
stellte
sich
lieber
vor,
dies
sei
die
offene
See,
wie
er
sie
in
seiner
Kindheit
gekannt
hatte.
Er
erinnerte
sich
deutlich
des
seltsam
erhabenen
Gefühls,
als
er
mit
seinem
Großvater
vor
dessen
Haus
gestanden
hatte.
Wie
der
alte
Mann
damals
nach
Westen
gedeutet
und
dazu
geflüstert
hatte
„Amerika!“,
als
gäbe
er
dem
Kind
ein
großes
Geheimnis
mit
auf
den Weg.
Ein
weiter
Weg,
dachte
Steven,
als
er
sich
zum
Eingang
des
Hotels
umdrehte,
wo
Norma
stand
und
ihm
schweigend
zusah,
wie
er
seine
Sachen
einpackte.
Warum
dachte
er
an
sie
immer
als
alte
Frau?
Als
er
zum
ersten
Mal
hier
ankam,
und
das
war
mehr
als
zehn
Jahre
her,
erschien
sie
ihm
schon
alt,
obwohl
sie
nur
wenige
Jahre
trennten.
Donnie
war
damals
noch
ein
halbes
Kind
gewesen,
elf
oder
zwölf
Jahre
alt.
Ein
in
sich
gekehrter
Junge,
der
seine
Zeit
gebraucht
hatte,
um
ihn
überhaupt
einmal
direkt anzusprechen.
Nach
einigen
Jahren
hatte
er
geglaubt,
einer
der
ihren
geworden
zu
sein,
Teil
der
Gemeinschaft
des
Tales.
Nur
weil
sie
ihn
wiedererkannten,
ihn
beim
Vornamen
nannten
und
ihn
an
den
harmloseren
ihrer
Unterhaltungen
teilnehmen
ließen.
‚Ich
hätte
mich
nicht
damit
zufrieden
geben
dürfen,‘
dachte
Steven.
Es
hätte
nichts
geändert.
Er
hatte
Anteil, an dem was geschehen war, aber keine Schuld. So hoffte er.
Nun
hatte
er
sich
entschieden
und
nun
gehörte
er
tatsächlich
dazu.
Selbst
wenn
er
niemals
zurückkehren
sollte,
war
er
Teil
des
Netzes
geworden,
in
dem
sie
alle
hingen,
um
sich
gegenseitig
zu
stützen
oder
sich
auch
zu
vernichten,
falls
es
nötig
wäre.
Dabei
wusste
er
doch
ganz
genau,
dass
er
wiederkommen
würde.
So
bald
wie
möglich.
Susan
hatte
ihm
sogar
ein
Zuhause
angeboten.
Wenn
er
nur
keinen
zweiten
Schritt
vor
dem
ersten
machte.
Wenn
er
sie
nur
nicht
mit
seinen
Gefühlen
überforderte.
Er
könnte
hier
zuhause sein. Wenn er es nur richtig anstellte.
Zehn
Jahre
lang
war
er
zu
Gast
gewesen,
hatte
Jahr
für
Jahr
gesehen,
wie
die
Dinge
im
Dorf
gleichblieben
oder
sich
veränderten.
Hatte
belustigt
zugehört,
wenn
ihm
der
neueste
Klatsch
zugetragen
wurde.
Hatte
mit
distanzierter
Trauer
gehört,
wer
in
der
Zwischenzeit
gestorben
war.
Er
hatte
die
wenigen
Babys,
die
in
dieser
menschenarmen
Gegend
zur
Welt
kamen,
mit
der
nötigen
Bewunderung
zur
Kenntnis
genommen,
um
ihre
Fortschritte
dann
von
Jahr
zu
Jahr
wie
im
Zeitraffer
wahrzunehmen.
Dieses
Jahr
konnten
sie
schon
laufen.
Ein
Jahr
später
sprachen
sie
schon.
Nun
gingen
sie
schon
zur
Schule.
Bald
würden
sie
fortgehen.
Die
Jahre
waren
an
ihm
vorbei
geflossen.
Er
hatte es kaum bemerkt.
Als
er
zum
ersten
Mal
hier
eintraf,
war
Susans
Tochter
Edith
noch
ein
kleines
Kind.
Jetzt
war
sie
vierzehn,
fast
fünfzehn.
Man
begann
sich
nach
ihr
umzusehen,
sie
würde
sicher
einmal
ebenso
schön
wie
ihre
Mutter,
sagten
die
Leute.
Sie
selbst
fand
sich
allerdings
zu
groß,
zu
schlaksig,
kein
Kind
mehr,
aber
auch
noch
keine
Frau.
Sie
würde
einmal
ihrer
Mutter
ähneln,
sagten
die
Leute.
War
das
gut?
Oder
war
es
das,
was
sie
auf keinen Fall werden wollte.
An
diesem
Morgen,
als
Steven
seine
Taschen
packte,
betrachtete
Edith
sich
einmal
mehr
kritisch
im
Spiegel.
Sie
suchte
nach
Spuren
ihres
Vaters
in
ihrem
Gesicht.
Zum
ersten
Mal,
seit
er
tot
war.
Und
zum
ersten
Mal
überhaupt.
So
lange
er
lebte,
hatte
sie
nicht
viel
darüber
nachgedacht,
was
sie
von
ihm
haben
könnte.
Für
sie
war
er
nur
der
Mann,
der
kam
und
ging,
wie
es
ihm
beliebte.
Und
wenn
er
wieder
fort
war,
zu
seinen
Weibern,
wie
es
hieß,
ohne
dass
sie
wirklich
verstand,
was
es
bedeutete,
mußte
man
sehr
vorsichtig
sein.
Die
Verzweiflung
brachte
ihre
Mutter
dazu,
ungerecht
zu
sein
und manchmal auch zuzuschlagen, ohne Grund.
Edith
wußte
genau,
wie
Verzweiflung
sich
anfühlte.
Es
gab
so
viele
Arten
davon:
Der
qualvolle
Tod
eines
Tieres,
das
Unverständnis,
das
ihr
die
ganze
Welt
entgegen
zu
bringen
schien,
die
unerklärliche
Wut
ihrer
Mutter.
Verzweiflung
war
ein
fester
Knoten
in
der
Brust,
der
seit
ihrer
frühesten
Kindheit
unauflösbar
mit
Dunkelheit
verknüpft
war.
Und
nun
gab
es
eine
weitere
Verzweiflung,
worüber
man
selbst
mit
der
Mutter
nicht
sprechen
konnte.
Das
war,
den
Griff
der
harten
Hand
eines
Mannes
zu
spüren,
seinen
schweren Atem nahe ihrem Gesicht und nicht entkommen zu können.
Wenn
es
das
war,
wovon
die
älteren
Mädchen
in
der
Schule
flüsterten
und
dabei
rot
wurden,
so
wollte
sie
lieber
nicht
erwachsen
werden.
Seltsamerweise
hatte
sie
sich
ihre
Mutter
und
ihren
Vater
immer
als
Paar
vorstellen
können.
Vielleicht
weil
sie
sich
so
ähnlich
waren?
Weil
beide
so
heftig
werden
konnten,
dass
es
keine
Grenze
mehr
zu
geben
schien.
Aber
nun
sollte
sie
sich
ihre
Mutter
mit
Steven
vorstellen?
Das
konnte
sie
nicht.



© Renate Dietrich

Ein leeres Boot am Strand - Leseprobe
Prolog
Das
über
ihm
zusammenschlagende
Wasser
ernüch-
terte
ihn
nur
für
einen
Augen-blick.
In
diesem
Moment
begriff
er,
dass
er
in
großer
Gefahr
war
und
vielleicht
sterben
würde.
Er
schlug
mit
den
Armen
um
sich
und
er-
reichte
noch
einmal
die
Oberfläche.
Doch
bevor
er
schreien
konnte,
hatte
ihn
die
Schwere
seiner
Kleider
und
der
Stiefel
zusammen
mit
den
höherschlagenden
Wellen
wieder
nach
unten
gezogen
in
die
Tiefe
der
fischigen
Finsternis.
Automatisch
hatte
er
die
Augen
geschlossen,
um
sie
vor
dem
brennenden
Salz-wasser
zu
schützen.
Aber
dennoch
sah
er
Susan
so
deutlich,
als
stünde
sie
vor
ihm
und
hielte
Edith
an
der
Hand,
Edith,
das
kleine
Mädchen
mit
großen
erschrockenen
Augen.
Nun
kamen
Mutter
und
Tochter
auf
ihn
zu.
Als
ob
sie
ihn
retten
könnten,
wenn
sie
ihn nur erreichten!
Er
riss
den
Mund
auf,
weil
er
das
mörderische
Zerren
in
der
Brust
nicht
mehr
ertragen
konnte
und
schluckte
salziges
Meerwasser,
während
sein
Körper
unterging und sein Bewußtsein in der Dunkelheit versank.
Kapitel 1
Es
hatte
seit
Tagen
geregnet.
Steven
hatte
nachts
die
Tropfen
gegen
die
Scheiben
trommeln
hören,
als
er,
wie
so
häufig
in
den
letzten
Nächten,
viel
zu
lange
wach
lag,
um
nicht
immer
wieder
in
demselben
Albtraum
unterzugehen.
Gegen
fünf
war
er
auf-gestanden
und
nach
draußen
gegangen.
Über
den
Bergrücken
im
Osten
hatte
sich
unterhalb
der
dichten
dunklen
Wolken
ein
Band
bläulichrosa
Scheins
ausgebreitet,
bis
schließlich
in
einem
überwältigenden
Augenblick
das
Licht
der
Sonne
durch-
gebrochen
war
und
das
Tal,
die
Berge
und
das
Meer
mit
silbrigem
Leuchten
überzogen
hatte,
als
wäre
dies
der
Augenblick der Schöpfung.
Als
er
nach
dem
Frühstück
die
große
Reisetasche
und
seine
Wanderstiefel
in
den
Kofferraum
packte,
war
die
Sonne
schon
lange
wieder
hinter
den
Wolken
ver-
schwunden,
die
jetzt
so
tief
hingen,
dass
er
die
andere
Seite
der
Bucht
nur
ahnen
konnte.
Für
einen
Augenblick
hatte
der
Regen
sich
eine
Pause
gegönnt,
aber
immer
noch
durchdrang
die
feuchte
Kühle
alles.
Er
blickte
auf
die
immer
noch
aufgewühlte
Wasserfläche
und
fühlte
wieder
die eisige Kälte und das abgrundtiefe Entsetzen.
Er
verscheuchte
die
Erinnerung
an
seinen
Albtraum,
so
gut
es
ging,
und
stellte
sich
lieber
vor,
dies
sei
die
offene
See,
wie
er
sie
in
seiner
Kindheit
gekannt
hatte.
Er
erinnerte
sich
deutlich
des
seltsam
erhabenen
Gefühls,
als
er
mit
seinem
Großvater
vor
dessen
Haus
gestanden
hatte.
Wie
der
alte
Mann
damals
nach
Westen
gedeutet
und
dazu
geflüstert
hatte
„Amerika!“,
als
gäbe
er
dem
Kind ein großes Geheimnis mit auf den Weg.
Ein
weiter
Weg,
dachte
Steven,
als
er
sich
zum
Eingang
des
Hotels
umdrehte,
wo
Norma
stand
und
ihm
schweigend
zusah,
wie
er
seine
Sachen
einpackte.
Warum
dachte
er
an
sie
immer
als
alte
Frau?
Als
er
zum
ersten
Mal
hier
ankam,
und
das
war
mehr
als
zehn
Jahre
her,
erschien
sie
ihm
schon
alt,
obwohl
sie
nur
wenige
Jahre
trennten.
Donnie
war
damals
noch
ein
halbes
Kind
gewesen,
elf
oder
zwölf
Jahre
alt.
Ein
in
sich
gekehrter
Junge,
der
seine
Zeit
gebraucht
hatte,
um
ihn
überhaupt
einmal direkt anzusprechen.
Nach
einigen
Jahren
hatte
er
geglaubt,
einer
der
ihren
geworden
zu
sein,
Teil
der
Gemeinschaft
des
Tales.
Nur
weil
sie
ihn
wiedererkannten,
ihn
beim
Vornamen
nannten
und
ihn
an
den
harmloseren
ihrer
Unterhaltungen
teilnehmen
ließen.
‚Ich
hätte
mich
nicht
damit
zufrieden
geben
dürfen,‘
dachte
Steven.
Es
hätte
nichts
geändert.
Er
hatte
Anteil,
an
dem
was
geschehen
war,
aber
keine
Schuld. So hoffte er.
Nun
hatte
er
sich
entschieden
und
nun
gehörte
er
tatsächlich
dazu.
Selbst
wenn
er
niemals
zurückkehren
sollte,
war
er
Teil
des
Netzes
geworden,
in
dem
sie
alle
hingen,
um
sich
gegenseitig
zu
stützen
oder
sich
auch
zu
vernichten,
falls
es
nötig
wäre.
Dabei
wusste
er
doch
ganz
genau,
dass
er
wiederkommen
würde.
So
bald
wie
möglich.
Susan
hatte
ihm
sogar
ein
Zuhause
angeboten.
Wenn
er
nur
keinen
zweiten
Schritt
vor
dem
ersten
machte.
Wenn
er
sie
nur
nicht
mit
seinen
Gefühlen
überforderte.
Er
könnte
hier
zuhause
sein.
Wenn
er
es
nur
richtig anstellte.
Zehn
Jahre
lang
war
er
zu
Gast
gewesen,
hatte
Jahr
für
Jahr
gesehen,
wie
die
Dinge
im
Dorf
gleichblieben
oder
sich
veränderten.
Hatte
belustigt
zugehört,
wenn
ihm
der
neueste
Klatsch
zugetragen
wurde.
Hatte
mit
distanzierter
Trauer
gehört,
wer
in
der
Zwischenzeit
ge-
storben
war.
Er
hatte
die
wenigen
Babys,
die
in
dieser
menschenarmen
Gegend
zur
Welt
kamen,
mit
der
nötigen
Bewunderung
zur
Kenntnis
genommen,
um
ihre
Fort-
schritte
dann
von
Jahr
zu
Jahr
wie
im
Zeitraffer
wahr-
zunehmen.
Dieses
Jahr
konnten
sie
schon
laufen.
Ein
Jahr
später
sprachen
sie
schon.
Nun
gingen
sie
schon
zur
Schule.
Bald
würden
sie
fortgehen.
Die
Jahre
waren
an
ihm vorbei geflossen. Er hatte es kaum bemerkt.
Als
er
zum
ersten
Mal
hier
eintraf,
war
Susans
Tochter
Edith
noch
ein
kleines
Kind.
Jetzt
war
sie
vierzehn,
fast
fünfzehn.
Man
begann
sich
nach
ihr
um-
zusehen,
sie
würde
sicher
einmal
ebenso
schön
wie
ihre
Mutter,
sagten
die
Leute.
Sie
selbst
fand
sich
allerdings
zu
groß,
zu
schlaksig,
kein
Kind
mehr,
aber
auch
noch
keine
Frau.
Sie
würde
einmal
ihrer
Mutter
ähneln,
sagten
die
Leute.
War
das
gut?
Oder
war
es
das,
was
sie
auf
keinen
Fall werden wollte.
An
diesem
Morgen,
als
Steven
seine
Taschen
packte,
betrachtete
Edith
sich
einmal
mehr
kritisch
im
Spiegel.
Sie
suchte
nach
Spuren
ihres
Vaters
in
ihrem
Gesicht.
Zum
ersten
Mal,
seit
er
tot
war.
Und
zum
ersten
Mal
überhaupt.
So
lange
er
lebte,
hatte
sie
nicht
viel
darüber
nachgedacht,
was
sie
von
ihm
haben
könnte.
Für
sie
war
er
nur
der
Mann,
der
kam
und
ging,
wie
es
ihm
beliebte.
Und
wenn
er
wieder
fort
war,
zu
seinen
Weibern,
wie
es
hieß,
ohne
dass
sie
wirklich
verstand,
was
es
bedeutete,
mußte
man
sehr
vorsichtig
sein.
Die
Verzweiflung
brachte
ihre
Mutter
dazu,
ungerecht
zu
sein
und manchmal auch zuzuschlagen, ohne Grund.
Edith
wußte
genau,
wie
Verzweiflung
sich
anfühlte.
Es
gab
so
viele
Arten
davon:
Der
qualvolle
Tod
eines
Tieres,
das
Unverständnis,
das
ihr
die
ganze
Welt
ent-
gegen
zu
bringen
schien,
die
unerklärliche
Wut
ihrer
Mutter.
Verzweiflung
war
ein
fester
Knoten
in
der
Brust,
der
seit
ihrer
frühesten
Kindheit
unauflösbar
mit
Dunkelheit
verknüpft
war.
Und
nun
gab
es
eine
weitere
Verzweiflung,
worüber
man
selbst
mit
der
Mutter
nicht
sprechen
konnte.
Das
war,
den
Griff
der
harten
Hand
eines
Mannes
zu
spüren,
seinen
schweren
Atem
nahe
ihrem Gesicht und nicht entkommen zu können.
Wenn
es
das
war,
wovon
die
älteren
Mädchen
in
der
Schule
flüsterten
und
dabei
rot
wurden,
so
wollte
sie
lieber
nicht
erwachsen
werden.
Seltsamerweise
hatte
sie
sich
ihre
Mutter
und
ihren
Vater
immer
als
Paar
vorstellen
können.
Vielleicht
weil
sie
sich
so
ähnlich
waren?
Weil
beide
so
heftig
werden
konnten,
dass
es
keine
Grenze
mehr
zu
geben
schien.
Aber
nun
sollte
sie
sich
ihre
Mutter
mit Steven vorstellen? Das konnte sie nicht.















